Archiv

(v.r.) Bischof Algermissen, Dr. Schallenberg, Martin Stanke und Rektor Prof. Dr. Richard Hartmann. - Foto: Christof Ohnesorge
04.02.05 - Fulda
Traditionelle Hrabanus-Maurus-Akademie / Eduard-Schick-Preis an Martin Stanke
„Ich halte es für eine eminente Aufgabe, daß die Theologie je neu die Frage nach Gott stellt und auf Basis der Heiligen Schrift, der Tradition und des kirchlichen Lehramtes eine Antwort gibt, allerdings eine unter dem Aspekt der heutigen Fragen für heutige Menschen.“ Dies betonte Bischof Heinz Josef Algermissen am Freitag in Fulda zum Abschluß der traditionellen Hrabanus-Maurus-Akademie, des Patronatsfestes der Theologischen Fakultät Fulda. Der Oberhirte gab seinem Wunsch Ausdruck, daß die Fakultät die Studierenden und alle Suchenden auf dem Weg der Gottsuche begleite und sich dabei vom authentischen Inhalt des katholischen Glaubens bestimmen lasse.
In seinem Schlußwort, das er in seiner Eigenschaft als Großkanzler der Theologischen Fakultät sprach, sagte Bischof Algermissen, er habe sein eigenes, stark biblisch geprägtes Gottesbild während seines Studiums auch an der Literatur überprüft. Werke wie Dostojewskis „Die Brüder Karamasoff“, Sartres „Der Teufel und der liebe Gott“, Borcherts „Draußen vor der Tür“ und Camus’ „Die Pest“ seien ihm hierbei hilfreich gewesen. Sodann verwies Algermissen auf Solschenizyns Erzählung „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, die in einem Gefangenenlager angesiedelt ist und in der das Bild von einem willkürlichen Gott, der die Kleinen übersehe, vorgestellt wird. Hier zeige sich deutlich, „wie sehr unser Gottesbild mit dem eigenen Ethos verbunden ist“. Sittliches Handeln hänge in seiner Bedingung bewußt oder unbewußt unmittelbar mit der Gottesfrage zusammen.
„In den vergangenen Wochen wurde angesichts der verheerenden Flutkatastrophe in Südostasien häufig die Theodizeefrage neu gestellt: Wie kann Gott zulassen, daß Zehntausende Menschen ihr Leben verlieren? Was ist das für ein Gott, an den wir uns in unseren Gebeten wenden?“ Diese Frage rief der Bischof in Erinnerung. Wenn Gott helfen könnte und dennoch zusehe, so könne man meinen, sei er ein Dämon, der sich an den Leiden der Menschen erfreue; wenn er angesichts der Tragödie nicht helfen könne, sei er nicht Gott. Der Limburger Bischof Franz Kamphaus habe in seiner Silvesterpredigt in Frankfurt betont: „Den Gott, der umstandslos zu unseren Wünschen und Träumen paßt, den gibt es nicht.“
Die heute gängige Gottesvorstellung entspreche den Träumereien von einer leidfreien Gesellschaft, die keine Wunden und keinen ungetrösteten Schmerz vertrage. Gott nach den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen harmlos zurechtzuträumen, so, wie man ihn gerade und sofern man ihn gerade brauche, entspreche nicht dem Gott der Bibel. „Jesus litt und starb, weil die Verhältnisse jenseits von Eden so sind, wie sie sind“, habe Bischof Kamphaus betont. Nur der im Gekreuzigten mitleidende und anteilnehmende Gott, der die Schmerzen, Ängste und Tränen seiner Menschen kenne, sei Lösung und Erlösung.
Bischof Algermissen ging auf die Antrittsvorlesung „Ist Gott moralisch? Was heißt und zu welchem Ende studiert man Moraltheologie?“ ein, die der neue Fuldaer Moraltheologe Prof. Dr. Peter Schallenberg hielt. Ähnlich wie der Theologe Klaus Demmer, der das sittliche Handeln des Menschen in enge Korrelation mit dem jeweiligen Gottesbild bringe, habe Schallenberg mit der Darstellung dessen, was Gott ist und sein Wesen ausmacht, Einsicht in seinen moraltheologischen Ansatz gewährt.
Festvortrag über den Sinn von Moraltheologie
Zu Beginn der Festakademie hatte Rektor Prof. Dr. Richard Hartmann Bischof Algermissen, Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez, Weihbischof Johannes Kapp, den Paderborner Weihbischof Matthias König, die anwesenden Domkapitulare und Professoren sowie zahlreiche weitere Gäste begrüßt. Hartmann wies darauf hin, daß in diesem Jahr der 1225. Jahrestag der Geburt des heiligen Hrabanus Maurus sei, das kommende Jahr 2006 hingegen seinen 1150. Todestag sehen werde.
In seinem Vortrag, der zugleich seine Antrittsvorlesung als Professor für Moraltheologie und christliche Gesellschaftslehre darstellte, machte Dr. Schallenberg deutlich, daß es eine der wichtigsten Aufgabe der Moraltheologie sei, „den Gedanken an Gottes gute Ewigkeit in die Zeit und in jede Einzelentscheidung eines menschlichen Lebens hineintragen zu dürfen“. Das Leben eines Christen sei deshalb nicht lediglich auf das Humane bezogen, weil er im Lichte von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi und des Denkens Gottes in der ihm zugemessenen Zeit eine sinnerfüllte Lebensgeschichte habe. Dazu gehörten Erfahrungen und Urteile über die Möglichkeit der Verwirklichung der großen Güter wie Treue, Vergebung und hingebende Liebe, betonte Schallenberg.
Zu Beginn seiner Antrittsvorlesung hatte er zum Thema hingeführt, indem er dem Fortschrittsglauben die Frage nach der Moralität und die Sorge um die Wahrheit entgegenstellte. Wahrheit meine die Sinnwahrheit des Lebens und Handelns, so Dr. Schallenberg. Sodann stellte er heraus, daß die Dinge vom Standpunkt der Erlösung her beleuchtete werden müßten. Theologie lehre, „unter der Bedingung des Schlechten zu leben, ohne ihm zu verfallen“. Das Wesen Gottes bezeichnete der Moraltheologe dabei als „spontane und ständige Erkenntnis allein des Guten und daraus folgendes Handeln“. Als Maßstab für die Bewertung des Menschen gelte das Urteil über seine Person, und absolut gültige Wertung sei die Liebe. Diese sei unabhängig von der Nützlichkeit des Menschen. Ethik brauche eine langfristige Perspektive in Gott.
Mehr noch als die universale Menschenwürde sei für das Individuum die Gottebenbildlichkeit des Menschen von grundlegender Bedeutung. Zu beachten sei, daß der Mensch von Natur verwandtschaftsbezogen handele, Gewalt gebrauche, auf Triebbefriedigung aus und eigennützig sei und sich nach der Moral der Masse richte. Dem stelle das Christentum mit dem hl. Paulus die Freiheit des Gewissens entgegen. „Im Aufbau der Kultur wandelt sich der Mensch selbst, wächst der innere Mensch“, so Schallenberg. Mit der Klärung und Ausweitung des Gottesbildes weite sich auch die menschliche Innerlichkeit. Doch sei der Mensch ein Abgrund, den nur Gott füllen könne.
Verleihung des Eduard-Schick-Preises an Martin Stanke
Bischof Algermissen gratulierte dem Diplomtheologen Martin Stanke zur Verleihung des Eduard-Schick-Preises. Stanke erhielt den mit 1.500 Euro dotierten Preis für seine herausragende Diplomarbeit mit dem Titel „Die Heilsmittlerschaft Jesu Christi und der Dialog der Weltreligionen“, die er bei Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez geschrieben hatte. Der Oberhirte betonte: „Ich bin als Bischof und Großkanzler auch ein wenig stolz über diese gute akademische Ausbildung an unserer Theologischen Fakultät“.
Die Akademieveranstaltung wurde musikalisch umrahmt durch Anne Rill und Manuel Stickel mit Cembalo und Gesang. +++
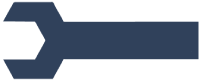
 Fulda informiert
Fulda informiert LK Fulda
LK Fulda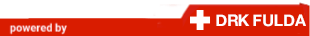

 Kontakt
Kontakt

