
Archiv
100 Jahre Rhönmuseum – Zwischen Tradition und Neuanfang
25.05.21 - Auch wenn es aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen ein leiser Geburtstag sein wird, Grund zum Feiern gibt es dennoch! In diesen Tagen begeht das Rhönmuseum in Fladungen sein 100-jähriges Jubiläum. Anlass genug, um die wechselvolle Geschichte und die Zukunftsperspektiven des Hauses näher zu betrachten.
Dr. Alfred Jacob (1874-1951) hieß der Mann der ersten Stunde! 1921 gründete der Mellrichtstädter Bezirksamtsmann das Rhönmuseums, welches fortan seinen ständigen Sitz im historischen Amtshaus (1628) in Fladungen finden sollte. Seine Gründungsidee eines Landschaftsmuseums war für die damalige Zeit typisch und modern zugleich. Das Beklagen einer sich fortschreibenden Technisierung sowie das Verschwinden althergebrachter Lebensformen und Techniken führte in jenen Jahren zu einer Fülle von Museumsgründungen. Doch der Gründungsgedanke eines grenzübergreifenden Museums für die gesamte Rhön, welches Ländergrenzen überwinden sollte, wirkt aus heutiger Sicht ausgesprochen modern.
Vereinsgründung in 1923
Bereits ein Jahr nach der Gründung musste Dr. Jacob sein Projekt hinter sich lassen und das noch junge Museum brauchte einen neuen Kopf an seiner Spitze. Der Fladunger Forstmeister Vogt sollte fortan die Geschicke des Hauses leiten, während eine Vereinsgründung im Jahre 1923 den dauerhaften Betrieb des Museums sicherte. In den Anfangsjahren rückte das Rhönmuseums verstärkt naturkundliche Aspekte in den Fokus. So fanden beispielsweise das Herbar Otto Arnold sowie die Insektensammlung Zeiller bereits in den 1920er Jahren Eingang in die Sammlung. Diese frühen naturkundlichen Sammlungen liefern heute wichtige Erkenntnisse über den Wandel der Flora und Fauna der Rhön. Doch nicht nur die Inventarbücher, sondern auch die Mitgliedslisten des Museumsvereins aus diesen Jahren lesen sich wie das "Who is Who" der Rhön.Der Aufwind des Rhönmuseums fand durch die bald folgenden Kriegsjahre einen abrupten Abbruch. Kriegsbedingt schloss das Rhönmuseum vorrübergehend seine Tore und die Ausstellungsräume wurden zeitweise anderen Nutzformen zugeführt, so beherbergte das historische Gebäude etwa das Kaiser-Wilhelm-Institut für Silikatforschung (heute Max-Planck-Gesellschaft).
Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg übernahm Franz Wald die Leitung des Hauses, welches er auch nach dessen Ende weiterführte. Unter Mitwirkung der Landesstelle für Denkmalpflege in München wurde nun ein systematischer Sammlungsaufbau vorangetrieben. Hierbei kam der Volkskunde fortan eine zentrale Stellung zu, was das Profil des Rhönmuseums nachhaltig prägte. Als Franz Wald im Jahre 1958 verstarb, ging die Museumsleitung an seinen Sohn Ludwig Wald über. Während seiner Amtszeit entwickelte das Rhönmuseum eine überregionale Strahlkraft und verzeichnete einen steten Sammlungszuwachs.
Besucherrekorde durch Grenztourismus
Der einstige Gedanke eines Gesamt-Rhönmuseums verlor im Laufe der Geschichte an Präsenz, jedoch wurde ihm durch die innerdeutsche Grenze nun auch politisch ein Ende gesetzt. Die historisch gewachsenen Sammlungen spiegeln somit auch die realpolitischen Geschehnisse des Grenzlandes Rhön sowie die besonderen Standortfaktoren der unterfränkischen Stadt Fladungen wider. Im Jahre 1975 folgte Albrecht Wald als neuer Museumsleiter der familiären Tradition. Mit ihm erlebte das Rhönmuseum eine stete Professionalisierung und wahre Besucherrekorde, die u.a. auf den vermehrten Grenztourismus zurückzuführen sind. So wuchsen die Besucherzahlen der 1980er Jahre quasi proportional zum wachsenden Grenztourismus. Ein Zwischenstopp im Rhönmuseum bzw. in der angeschlossenen Grenzinformationsstelle, gehörten gewissermaßen zum Standardprogramm eines jeden Grenztouristen. Die Wiedervereinigung veränderte die Situation jedoch nachhaltig. Die Folgejahre waren geprägt von fehlenden Gästen, fehlenden Ressourcen, fehlenden Innovationen und Perspektiven. Nicht nur die Rhön hatte sich gewandelt, sondern auch die Ansprüche an ein Museum!Im Laufe seiner Geschichte durchlief das Rhönmuseum vielfache Wandlungen, doch nun musste die Zukunft des Rhönmuseums neu ausgelotet werden. Machbarkeitsstudien, Bürgerworkshops und Finanzierungspläne säumten den Weg. Nach einer umfangreichen Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes sowie der Formierung eines neuen Trägers aus Landkreis Rhön-Grabfeld und der Stadt Fladungen im Jahr 2015 war das Fundament für die Zukunft des Rhönmuseums gelegt. Auch personell wurde ein Neustart eingeläutet: 2018 erhielt das Haus mit Eva-Maria König eine neue wissenschaftliche Leitung.
Der Tradition und Zukunft verpflichtet
Doch nicht alles ändert sich: Was einst dem Gründer wichtig schien, die Überwindung von Landesgrenzen, soll künftig wieder stärker in den Fokus gerückt werden! Dabei sieht sich das Rhönmuseum 2.0 der Tradition sowie der Zukunft verpflichtet. Während sich die frühe Sammeltätigkeit des Rhönmuseums als ein bewusstes Innehalten verstehen lässt und zugleich ein Erklärungsmodell für den Versuch bietet, die Rhön als "einheitlichen Kulturraum" zu beschreiben, soll die Rhön zukünftig in ihrer Diversität und ihrem Facettenreichtum präsentiert werden. Denn die Rhön ist vielfältig: sie ist Stadt und Land, Industriestadtort und Agrargebiet. Sie ist hessisch, bayerisch und thüringisch zugleich. Sie ist Heimat der Rhöner* und ihrer Artefakte.Nicht nur die Vorstellungen von der "Kulturlandschaft Rhön" haben sich in den letzten einhundert Jahren gewandelt, sondern auch die Anforderungen an ein Museum. Das heutige Rhönmuseum versteht sich als Besucher-orientiertes Museum, als diskursiver Ort mit offenen Türen. Als Regionalmuseum und Regionalplattform möchte es künftig ein breites Publikum anzusprechen und attraktive Angebote für Einheimische sowie für Touristen* schaffen. Bis zur langersehnten Wiedereröffnung im Jahre 2022 müssen sich die Museumsfreunde noch etwas gedulden, doch die Basis für die nächsten 100 Jahre ist geschafft! Erste Einblicke in die Neukonzeption bieten neben den regelmäßigen Sonderveranstaltungen auch die Social-Media-Angebote des Rhönmuseums. (pm) +++
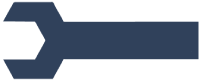
 Fulda informiert
Fulda informiert LK Fulda
LK Fulda





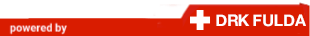

 Kontakt
Kontakt

