Archiv

Der Schwarze Apollo - einer der schönsten und seltensten Tagfaltern Deutschlands.... - Karl-Heinz Kolb
18.10.03 - Oberelsbach
Artenschutzprojekt "Schwarzer Apollo - fliegender Rhön-Edelstein"
Apollo - Landung auf dem Mond, Gott der Dichtkunst oder ein schöner Mann. Aber wer denkt dabei an einen Schmetterling? Naturschützer im Biosphärenreservat Rhön haben diesen in ihr Herz geschlossen: Der Schwarzen Apollo steht im Mittelpunkt eines Artenschutzprojekts in der bayerischen Rhön.
"Nicht nur die Schönheit und Seltenheit des Schwarzen Apollos legen den Vergleich mit einem Edelstein nahe. Dieser zu den Ritterfaltern gehörende Tagfalter ist, wie das auch bei kostbaren Steinen der Fall ist, auch nur an ganz wenigen Stellen zu finden", sagt Diplom-Biologe Karl-Heinz Kolb, der das Artenschutzprojekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt betreut. Bundesweit komme der Tagfalter nur vereinzelt vor.
Kolb, Mitarbeiter der Bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, erklärt die Seltenheit des Schmetterlings mit dessen sehr spezifischen Ansprüchen an den Lebensraum: Die Larven seien für ihre Entwicklung auf besonnte Wuchsorte des Lerchensporns an Waldrändern, breiten Waldwegsäumen und in waldnahen Hecken angewiesen. Nur dort, wo dieser Frühjahrsblüher vorkomme, könne sich die Schmetterlingsraupe entwickeln - denn sie fresse nichts anderes. Die erwachsenen Falter hielten sich an Säumen am Waldrand und im Wald, aber auch auf Waldwiesen auf, wo sie an verschiedenen Pflanzen Nektar saugen. Bevorzugt flögen sie rote und violett-rote Blüten an. Damit der Schwarze Apollo existieren könne, so Kolb weiter, müssten die Ansprüche der Schmetterlingslarven und des erwachsenen Falters zusammen erfüllt sein.
Seit 1996 finanziert die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ein länderübergreifendes Artenschutzprojekt im Biosphärenreservat Rhön, welches unter Begleitung der Arbeitsgemeinschaft Artenschutz als informelles Gremium von Behörden, Verbänden und Einzelpersonen umgesetzt wird. Dem Schwarzen Apollo - bundesweit in der Roten Liste als "vom Aussterben bedroht" geführt - gilt dabei besondere Aufmerksamkeit: Karl-Heinz Kolb beschäftigt sich detailliert mit diesem bemerkenswerten Falter. "Durch genauere Erforschung der Vorkommen des Schwarzen Apollos und des Lerchensporn als Raupenfutterpflanze wollen wir dessen Lebensraumansprüche besser verstehen", erläutert Kolb. Hierbei werde neben der Ermittlung der Individuenstärke der einzelnen Teilpopulationen in der bayerischen Rhön - regional das Hauptvorkommensgebiet - auch betrachtet, in wie weit diese miteinander in Verbindung stünden und sich untereinander austauschen könnten: "Ein solcher Austausch ist für die Erhaltung der genetischen Vielfalt der Art besonders wichtig", weiß der Biologe.
Neben dem Falter selbst nimmt Kolb auch dessen Lebensraum genau unter die Lupe, um festzustellen, wo und wie die Lebensbedingungen des "fliegenden Edelsteins" verbessert werden können. Der Apollo wird, so der Biologe, erfolgreich gefördert durch die Mahd bestimmter Brachflächen, das Auslichten des Waldes, wo Lerchensporn vorkommt, sowie die Pflege von Hecken. Diese Landschaftspflege-Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rhön-Grabfeld und den Forstämtern umgesetzt.
Dieter Weisenburger, Leiter der unteren Naturschutzbehörde, verweist auf positive Auswirkungen, die sich gerade im zurückliegenden warmen Sommer gezeigt hätten: In derart gepflegten Gebieten seien mehr Falter als bisher zu beobachten. Von diesen Maßnahmen profitierten auch andere Pflanzen- und Tierarten der offenen Waldrandbereiche und Heckengebiete.
Das übergreifende Ziel - die Klammer des Projekts - soll nun die Ausarbeitung eines so genannten "Lebensraumverbundes" sein, unterstreicht Biologe Kolb: Die Naturschützer wollen versuchen, die teilweise isolierten Teilpopulationen wieder miteinander zu vernetzen und so der Art ein langfristiges Überleben in der Rhön zu sichern. "Für Tiere, deren Vorkommen auf wenige und wie Inseln im Meer voneinander isolierte Reste zusammengeschrumpft sind, ist der Biotopverbund der Schlüssel, ihr Aussterben zu verhindern", unterstreicht Privat-Dozent Dr. Eckhard Jedicke, der Leiter des Artenschutzprojekts der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Das neue Bundesnaturschutzgesetz fordere von den Ländern entsprechende Projekte.
Das Artenschutzprojekt ist auf Spenden angewiesen. Diese können unter dem Stichwort "Rhön" geleistet werden an die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, Kto. 80002, Sparkasse Frankfurt, BLZ 500 502 01. +++
Ansprechpartner:
- Dipl.-Biol. Karl-Heinz Kolb, Regierung von Unterfranken Bayerische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön, Tel. (0 97 74) 91 02-0, karl-heinz.kolb@brrhoenbayern.de
- für das Artenschutzprojekt insgesamt: PD Dr. Eckhard Jedicke, Projektleiter, Tel. (0 56 91) 71 97, info@jedicke.de
- bei Rückfragen zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt: Wolfgang Fremuth, Referatsleiter Europa, Tel. (069) 94 34 46-33, fremuth@zgf.de +++
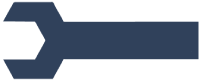
 Fulda informiert
Fulda informiert LK Fulda
LK Fulda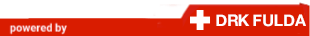

 Kontakt
Kontakt

