
Archiv

Hessen gegen den Glücksspielvertrag
07.06.16 - Ein deutliches “Nein” zum Glücksspielvertrag gab es seitens der hessischen Regierung. Zumindest wurde diese Absage von der Wiesbadener Staatskanzlei an die anderen Bundesländer gerichtet. Dann folgte eine Besprechung in Berlin. Der Grund: Hessen und damit Regierungssprecher Michael Bußer hält Teile des Glücksspielgesetzes für rechtswidrig und verweigert eine entsprechende Unterschrift. Ob die Alternative – ein eigenes, hessisches Glückspielgesetz – zur Realität wird oder ob es zu einer Einigung kommen kann, steht aktuell in den Sternen.
Rückblick: Das geschah bisher mit Blick auf das Glücksspiel
Seit dem Jahr 2012 gilt der Glücksspielstaatsvertrag, kurz GlüStV. Im Paragraf 1 wurden diese Ziele festgelegt:
- „das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,
- durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,
- den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,
- sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden und
- Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen.“
Doch auch das ist nur ein Bruchteil dessen, was nun für Aufruhr sorgt. Im Detail bedeutet das nämlich, dass der Ärger aus dem Jahr 2012 bis heute nicht gelöst ist, denn: Laut Glücksspielvertrag sollten Online-Casinos mit Sitz in Deutschland verboten werden. Da allerdings Lotterien und Sportwetten ausnahmsweise genehmigt werden, widerspricht dies dem EU-Recht. Globaler betrachtet bedeutet dies, dass die Länder nach aktuell gültigem Recht am staatlichen Lottomonopol festhalten. Und das obgleich sie eigentlich dazu verpflichtet wurden, den Markt für Privatanbieter zu öffnen.
Hessen stellt deutliche Forderungen auf
Spannend ist in dem Zusammenhang vor allem diese Entwicklung: Obgleich sich die Bundesländer Deutschlands nicht an die Vorgaben gehalten haben, konnten sich die privaten Anbieter am Markt etablieren. Allerdings taten sie dies mit Lizenzen aus dem EU-Ausland und damit ohne nötige Rechtssicherheit. Hessens Innenminister Peter Beuth formulierte diese Forderungen:
- Online Casinos sollen legalisiert werden.
- Der Schwarzmarkt soll verringert werden.
- Der Fiskus soll von den Einnahmen profitieren – ähnlich wie von der Spielapparatesteuer.
- Die Begrenzung auf 20 Sportwetten-Lizenzen soll abgeschafft werden.
- Das Online-Einsatzlimit von 1.000 Euro soll einem Verlustlimit von 1.000 Euro weichen.
- Eine Aufsichtsbehörde unabhängig von Politik und Lizenzen soll eingerichtet werden.
Beim Streit um den Glücksspielvertrag geht es (auch) ums Geld
Mit Blick auf die Daten aus dem Branchenreport zum Spiel-, Wett- und Lotteriewesen zeigt sich auch ein weiterer Grund, warum der Ruf nach einer Legalisierung des Glücksspiels einen hohen Stellenwert hat: nämlich des Geldes wegen. Prognosen zufolge soll der deutschlandweite Umsatz in der Glücksspielbranche 13,54 Milliarden Euro betragen. Eine weiter steigende Tendenz ist nicht auszuschließen.
Für den Fiskus ist das ein lukratives Geschäft, denn er schielt nicht nur auf die Spielbankabgaben, sondern auch auf die Umsatz-, Gewerbe sowie Körperschaftsteuer. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass auch Glücksspielumsätze an Spielgeräten umsatzsteuerpflichtig sind. Der Steuersatz beträg 19 %. Bei einem Umsatz von 13,54 Milliarden Euro geht es dabei um eine Summe von 2,56 Milliarden Euro. Doch das ist noch nicht alles. Von den Gewinnen, die aus Glücksspielen erwirtschaftet werden, müssen die betroffenen steuerpflichtigen Unternehmen Körperschaftsteuer entrichten. Geht man davon aus, dass die Glücksspielunternehmen als juristische Person dem Körperschaftssteuersatz von 25% unterliegen, so würden vom zu erwartenden Gewinn einige Millionen oder gar Milliarden Euro in die Staatskasse fließen – von den Einnahmen aus Gewerbesteuer ganz zu schweigen. Es ist anzunehmen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich die Länder einigen und einen Schlüssel finden, der die Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt.
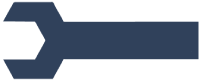
 LK Fulda
LK Fulda
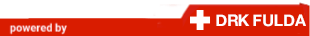

 Kontakt
Kontakt

