

Rendezvous mit dem Todesbaum - Bemerkungen von Rainer M. Gefeller
11.04.25 - Wir sind hier nicht willkommen. Zufahrt untersagt, Zutritt unerwünscht. Aber wenn man doch einfach nicht widerstehen kann?! Domdechanei Fulda, gleich hinter dem Zugangstor und durch eine weitere hohe Mauer geschützt: da stehen sie, miteinander verwachsen in lebenslanger Partnerschaft – zwei Bäume von düsterer Schönheit, magisch und... gefährlich! Darf ich vorstellen: Die Eibe, Taxus Baccata. Der knorzige Baum steckt voller alter Geheimnisse und ist super-modern: manchmal weiß man gar nicht, welchen Geschlechts dieses Buschwerk ist. Vor ein paar hundert Jahren noch der begehrteste Baum der Welt, und jetzt: nahezu ausgerottet. Die beiden Super-Oldies hier in Fulda haben das Gemetzel überlebt. Aber bleiben wir auf der Hut: Die Eibe strotzt nur so vor lebensbedrohlichem Gift. Am besten, wir gucken erstmal nur.
Das soll ein Baum sein? Wie ein altes Borstenvieh macht sich die älteste Eibe der Welt auf dem Kirchhof von Fortingall breit. Seit 5.000 Jahren soll’s dieser Baum hier schon aushalten, seit einigen hundert Jahren pilgern Eiben-Freunde in dieses ansonsten gähnend langweilige Nest in der Mitte Schottlands, um in seine Mysterien einzutauchen. Vor zehn Jahren hat der Botaniker Max Coleman zur weiteren Mythenbildung ein biologisches Rätsel entdeckt. 5.000 Jahre lang galt, dass man den Eiberich an seinen knubbligen Zapfen erkennt, die sich im Herbst herausbilden. Miss Eibe hingegen zeigt gern ihre knackroten "Beeren". Da stand nun Mr. Coleman unter dem berühmtesten Baum seines Landes, schaute nach oben – und sah, was es nicht geben konnte: aus diesem feisten Nadelholz-Kerl ragte ein Ast hervor, der eindeutig rote Frauen-Früchte trug. Der Biologe glaubt, eine "Veränderung im hormonellen Gleichgewicht" habe die Geschlechtsumwandlung ausgelöst. In der "Welt" ereiferte sich ein Leser: "Jetzt wissen nicht mal mehr die Bäume, ob sie Männlein oder Weiblein sind." Für britische Transgender-Aktivisten hingegen ist unsere Uralt-Eibe ein Held (oder eine Heldin?) der neuen Zeit: "Gut gemacht, alter Junge!"
Ja, die Eibe kann einem echt Kopfschmerzen bereiten. Die älteste Baumart Europas wucherte bereits vor 150 Millionen Jahren bei uns herum und war schon in der Antike ein Mythos, als Wächter der Unterwelt. Den Kelten war sie als Druidenbaum heilig, die nordische Götterstadt Asgard war mit Eibenbäumen bepflanzt. Der römische Gelehrte Plinius taufte die Eibe "Baum des Todes"; der dunkle Nadelbaum wurde auf Friedhöfe gepflanzt, die passende düstere Natur-Kulisse für die Verstorbenen. "Man hielt sogar einen längeren Aufenthalt in seinem Schatten für gefährlich", schrieb der Biologe und Philosoph Ernst Hallier 1895 in der populären Zeitschrift "Vom Fels zum Meer". In seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" widmete Theodor Fontane einer Eibe in Berlin eine schwärmerische Betrachtung; ein Gedicht gehörte natürlich auch dazu:
Die Eibe
Schlägt an die Scheibe.
Ein Funkeln
Im Dunkeln.
Wie Götzenzeit, wie Heidentraum
Blickt ins Fenster der Eibenbaum.
In Fulda stehen vier Eiben auf der "Liste der Naturdenkmale": die beiden schönen Kumpel an der Domdechanei, ein weiterer im Bischofsgarten und einer in einem Privatgarten; gut behütet sind sie alle – vor allem wir vor ihnen. Fahren wir mal rüber in die thüringische Rhön. In unserem Nachbarland haben die meisten Eiben in Deutschland überlebt, 33.000. Der Ibengarten am Rande des Dermbacher Ortsteils Glattbach hat fast 400 von ihnen eine Art Schutzwald geboten; 50 Eiben sind bereits über 500 Jahre alt. Fontane hat schon vor über 150 Jahren die Gefühle beschrieben, die auch heutige Wanderer überkommen können: "Die Eibe, so scheint es, steht auf dem Aussterbe-Etat der Schöpfung. Vor der waldvernichtenden Axt älterer Ansiedler und neuer Industrieller haben sich nur einzelne knorrige Taxusbäume retten können, die jetzt, wo wir ihnen begegnen, ein ähnliches Gefühl wecken wie die Ruinen auf unseren Bergesgipfeln. Zeugen, Überbleibsel einer längst geschwundenen Zeit." In ganz Deutschland, berichtet die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, gibt es nur noch 60.000 Eiben.
Gleich hinter Glattbach, den Feldweg hoch, da ducken sich schon die ersten auf die Wiesen: verfilzt, verknorpelt, verwachsen sind sie, und irgendwie scheint sich jeder selbst genug zu sein. Wer dem Wanderweg auf den Berg folgt, entdeckt immer mehr, und im Schutz der Buchen sind sie auch immer älter geworden. Wie nähert man sich einer gefährlichen Schönheit? Gaaanz vorsichtig. Vielleicht sollten wir ein paar beruhigende Schwärmereien vor uns hinmurmeln – Briten-König Charles spricht ja bekanntlich auch mit seinen Pflanzen. Aber bloß keinen Baum umarmen, wie es ja beim "Waldbaden" in Mode gekommen ist. Mittelalterliche Baumfäller jedenfalls klagten öfter mal über Kopfschmerzen, Schwindel, Halluzinationen...
Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt: dank Taxin ist die Eibe hochgiftig – schon "wenige hundert Gramm Eibennadeln" (ein Teelöffel!) werfen Kühe, Pferde und Schafe aus den Hufen. "Der Tod tritt meist innerhalb weniger Stunden ein". Im Mittelalter pflegten die Bauern ihr Vieh noch in den Wald zu treiben, genau in die mit weichen Nadeln gespickten Arme der Eiben... An der Eibe ist alles giftig, bis auf den Samenmantel. Das sind die im Herbst rot leuchtenden beerenartigen Früchte. Die sollen besonders lecker gewesen sein in Omas Eiben-Marmelade. Wer sich den Rest einverleibt, ist in Lebensgefahr. Als tödliche Dosis gelten für Menschen 50 bis 100 Gramm Eibennadeln (das weiß man aus der Untersuchung von Selbstmordversuchen). Die Eibe ist ein wütender Zerstörer: nach einer Stunde spürt man Übelkeit, Brechreiz, Schwindel, Bauchschmerzen. Danach Bewusstlosigkeit, Atembeschwerden, Atemlähmung... Die meisten Gift-Opfer sind innerhalb von 24 Stunden tot. Catuvolcus, König der Eburonen, hat sich im Jahr 53 vor Christi Geburt mit einem Becher Eibensaft umgebracht. Er wollte nicht mehr in den Krieg gegen Cäsar ziehen.
Im Leben einer Eibe ist die Amtszeit eines Herrn Trump nur ein kurzes Nadelzwicken. "Greife nie in ein fallendes Messer!" Den Spruch kann jeder Bankberater aufsagen, und er wird gerne eingesetzt beim derzeitigen Börsen-Helterskelter. Ist klar, was unsere Finanz-Wächter damit sagen wollen: Wäre blöd, wenn wir gerade jetzt unsere drei durch Trump zerschredderten Aktien verhökern würden. Für die Eibe ist der Spruch vermutlich ein alter Hut. Vor allem im hochgerüsteten Mittelalter, als unser Baum wichtiger Bestandteil der Kriegswirtschaft war, waren niedersausende Messer eine direkte Bedrohung für alle Lebensformen. Aus Eibenholz wurde die Artillerie der mittelalterlichen Heere gefertigt: Kein Baum eignete sich mehr als die ebenso stahlharte wie geschmeidige Eibe für den Bau der damals tückischsten Waffe – des Langbogens.
Als Ötzi, die spätere "Gletschermumie", vor 5.500 Jahren noch durch die Jungsteinzeit stapfte, hatte er bereits einen 1,83 Meter großen Eiben-Bogen dabei. Die Waffe überragte den kleinen Jäger um 23 Zentimeter. Es dauerte noch ein paar tausend Jahre, bis das Eiben-Geschütz zur Lenkwaffe wurde, die Kriege entschied – vor allem für die englischen Kämpfer. Langbogenschützen konnten bis zu zehn Pfeile pro Minute abfeuern, mit einer Reichweite von über 200 Metern und einer Geschwindigkeit von über 150 Kilometern pro Stunde. Die Pfeile durchschlugen Kettenrüstungen und Eichentore. Wenn die Geschosse auf die gegnerischen Krieger niederregneten, waren sie häufig schon ohne Nahkampf besiegt. Der Triumph der Eibenbögen besiegelte freilich auch ihr Ende: In Europas Wäldern, Parks, und auf Friedhöfen wurden die Eiben Opfer massenhafter Raubzüge, ganze Schiffsladungen wurden auf die britische Insel geschafft. Übrig blieben nur ein paar Eiben-Waisen.
Im vergangenen Dezember dichtete die bayerische "Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau" eine Warnung über "dunkles Grün in dunkler Zeit". Zwar ist die Eiben-Hecke "schnittverträglich" wie der Buchsbaum und kann demzufolge in jede Form geschnippelt werden, die Garten-Künstlern gefällt. Andererseits: Giftig bleibt giftig! Im eigenen Garten möge man Rücksicht nehmen auf Kinder und Haustiere, an Kindergärten und auf Spielplätzen "raten wir von einer Pflanzung ab". Das ist ja schade. Die Eibe ist nicht gerade eine Entwicklungs-Granate: nach 20 Jahren sieht man die ersten Blüten, nach ein paar Jahrzehnten ist sie erwachsen. Wie sollen wir da die Eiben retten? Ist gar nicht nötig, urteilt der Forstwissenschaftler Raphael Klumpp: "Die Eibe ist so anpassungsfähig, dass sie langfristig zu den Klimagewinnern zählen wird." Ach, dann brauchen wir ja nur ein paar Jahrhunderte abzuwarten – schon wissen wir Bescheid! (Rainer M. Gefeller) +++
Echt Jetzt! - weitere Artikel
























































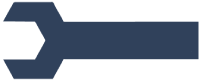
 Fulda informiert
Fulda informiert LK Fulda
LK Fulda









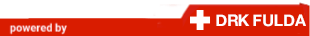

 Kontakt
Kontakt

